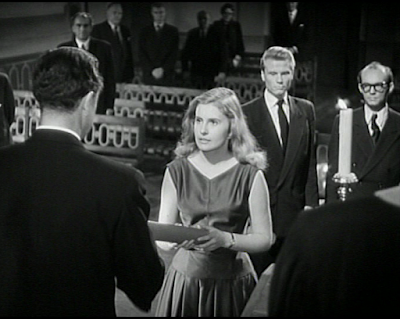Inhalt: Helene Willfüer (Ruth Niehaus) wird feierlich die
Doktorwürde von Professor Matthias (Hans Söhnker) verliehen – ein nicht
selbstverständliches Ereignis. Zwar erweckte Helene sofort große Aufmerksamkeit
bei ihrem Doktor-Vater, der die intelligente, engagierte junge Frau zu sich als
Assistentin ins Forschungslabor holte, aber ihr Auftauchen setzte unaufhaltsame
Prozesse in Gang. Yvonne Matthias (Elma Karlowa), die Ehefrau des Professors, erkennt in ihr sofort eine Nebenbuhlerin.
Nicht nur, dass ihr Mann viel Zeit
mit ihr im Labor verbringt, mehr noch ärgert Yvonne, dass Helene sich mit Dr. Reiner (Erik
Schumann) anfreundet, einem Arzt, der wie sie der Musikleidenschaft frönt. Unglücklich in ihrer Ehe, war sie mit Dr. Reiner ein Verhältnis eingegangen. Doch im Gegensatz zu ihr leidet der junge Arzt, der sich selbst Schmerzmittel injiziert, an dieser Situation. Für ihn ist Helene ein Hoffnungsschimmer und er verliebt sich in die junge Frau. Sie scheint seine Gefühle zu erwidern, aber tatsächlich versucht sie nur ihre Gefühle für den Professor zu vergessen…

Ein großer Teil der in den 50er Jahren in Deutschland
herausgekommenen Filme waren Remakes früher Tonfilme, häufig stammten die
ersten Kinofassungen populärer Literatur noch aus der Stummfilmzeit. Auch
"Studentin Helene Willfüer", basierend auf dem 1928 erschienenen
Roman "Stud. chem. Helene Willfüer" von Vicki Baum, führt unmittelbar
zurück in die Zeit der Weimarer Republik, erlebte 1930 am Ende der
Stummfilm-Ära eine erste Verfilmung mit Olga Tschechowa in der Hauptrolle, und
steht doch exemplarisch für das Frauenbild der 50er Jahre, das sich in den drei
Jahrzehnten zuvor nur wenig gewandelt hatte. Autorin Vicki Baum, von deren
Romanen heute nur noch "Menschen im Hotel" (verfilmt USA 1932 und
Deutschland 1960) über einen gemäßigten Bekanntheitsgrad verfügt, verdankte
"Stud. chem. Helene Willfüer" ihren Aufstieg zu einer der
erfolgreichsten Schriftstellerinnen der Weimarer Republik. Ihr blieb die
Anerkennung der seriösen Literaturkritik zwar verwehrt, aber ihre der
Unterhaltungsliteratur zugeordneten Bücher gestatten heute noch einen
authentischen Blick in den damaligen Zeitgeist.

"Stud. chem. Helene Willfüer" entstand in der Phase
einer "neuen Sachlichkeit" nach dem 1.Weltkrieg und zeichnete das
Bild einer selbstständigen Frau, die Wert auf ein modernes, an pragmatischen
Gesichtspunkten orientiertes attraktives Äußeres legte und trotz eines
unehelichen Kindes ihr Studium zu Ende führte, um einem Beruf nachzugehen.
Damit berührte Vicki Baum zwar Tabus, bewies aber Gespür für eine Gesellschaft
im Wandel - ein Grund für ihren Erfolg, neben ihrem Geschick auch konservative
Gemüter mit einem Ende zu befriedigen, das den Status quo wieder herstellte. Diese
unentschiedene Haltung wurde ihr zwar vorgeworfen, lässt aber übersehen, wie
sehr allein schon die Schilderung einer versuchten Abtreibung provozierte. Nicht
nur in den 20er Jahren, auch der Drehbuch-Fassung zu Rudolf Jugerts Film ist
dieser Kompromiss anzumerken, denn Mitte der 50er Jahre galten die in "Stud.
chem. Helene Willfüer" publikumswirksam ausgebreiteten Lebensumstände
einer jungen Studentin keineswegs als opportun. Im Gegenteil hatte die Zeit des
Nationalsozialismus die vorsichtige Emanzipationsbewegung der 20er Jahre wieder
zurückgeworfen.
„Die ist richtig – mit dem Einen kommt sie, mit dem Anderen
geht sie“

Mit dieser wenig anerkennend gemeinten Aussage stand die
Konzertbesucherin sicherlich nicht allein. Helene Willfüer (Ruth Niehaus) war
in Begleitung ihres Doktor-Vaters Professor Matthias (Hans Söhnker) zum
Konzert-Saal gekommen, um diesen gemeinsam mit dem Arzt Dr. Rainer (Erik
Schumann), der zuvor als Dirigent das Konzert gegeben hatte, wieder zu
verlassen. Eine Frau riskierte schnell ihren „guten Ruf“, doch Ruth Niehaus erwies
sich als Idealbesetzung zwischen größtmöglicher Ernsthaftigkeit und einem frei
bestimmten Leben. Wie schon in ihrer ersten Hauptrolle im Heimatfilm „Rosen
blühen auf dem Heidegrab“ (1952) blieb ihre Sexualität hinter ihrem so schönen,
wie züchtigen Äußeren nur unterschwellig spürbar und wirkte sie im Umgang mit
den beiden Männern nie berechnend. Diese Position nahm Elma Karlowa als Yvonne
Matthias ein, die Ehefrau des Professors, die ihn nicht nur mit Dr.Rainer betrügt,
sondern alles unternimmt, um die Nebenbuhlerin Helene Willfüer auszuschalten. Karlowa,
die schon in „Rosenmontag“ (1955) an der Seite von Ruth Niehaus spielte, gab hier
den weiblichen Antipoden und schuf damit erst den Freiraum für Willfüers den
damaligen Regeln widersprechendes Verhalten.

Es ist Jugert und seinem Drehbuchautoren Frederick Kohner
hoch anzurechnen, dass sie diese negativ besetzte Figur nicht vollständig demontierten,
sondern in ihrer Emotionalität menschlich nachvollziehbar werden ließen. Es
bleibt der Moment in Erinnerung, in dem sie ihre Einsamkeit an der Seite eines
Ehemanns ausdrückt, für den sie ihre Karriere als Musikerin aufgab, der seine
Zeit aber am liebsten im Forschungslabor verbringt. Hans Söhnker, in den 50er
Jahren prädestiniert für die Rolle des älteren Liebhabers („Männer im
gefährlichen Alter“ (1953)), kann hier nur schwerlich vermitteln, wie es zu der
Verbindung zu der sehr emotionalen Musikerin gekommen war. An Karlowas Seite
wirkt er als Forscher seltsam passiv, fast schon hilflos gegenüber dem exaltierten
Verhalten seiner Ehefrau. Wirklich konsequent ist er nur gegenüber Helene
Willfüer, die er nicht nur sofort als Assistentin zu sich ins Labor holt,
sondern niemals Zweifel an ihr äußert – weder als sie wegen Mordverdachts
verhaftet wird, noch als sie ein uneheliches Kind bekommt.

Diese Idealisierung eines gereiften, hoch angesehenen Mannes,
dessen Haltung außerhalb der vorherrschenden Meinung stand, hatte schon in
Baums Roman die Funktion, eine größere Akzeptanz beim Leser für die
Protagonistin zu erzeugen – und sorgte letztlich auch für deren Legitimation. Jugert
deutete dieses Ende im Gegensatz zu Vicki Baum nur an, aber er blieb der
Romanvorlage in ihrem unterhaltenden Charakter treu. Besonders Harald Juhnke
als Kommilitone Meier und Ina Peters als quirlige Mitbewohnerin nehmen der
Handlung viel von ihrer Ernsthaftigkeit. Wenn Juhnke sich den Säugling packt,
um ihn mit modernen Methoden zu windeln, hat der Zuschauer schon fast
vergessen, dass Helene Willfüer den Heiratsantrag des Kindsvaters ablehnte,
weil sie ihre Karriere nicht als Ehefrau eines Landarztes aufgeben wollte,
sondern stattdessen vorhatte, das Kind, von dem er nichts wusste, abzutreiben.

Die von Erik Schumann gespielte tragische Rolle des jungen
Arztes, der lieber Musiker geworden wäre als die Familien-Tradition als Landarzt
fortzusetzen, wurde in Jugerts Film zusätzlich in Richtung einer
Kriminalhandlung gewichtet. Nach dem abgelehnten Heiratsantrag stirbt er durch
eine Injektion, wofür Helene Willfüer verantwortlich gemacht wird, die den
Toten auffindet. Die gesamte folgende nicht in Baums Roman enthaltene Gerichtssequenz
wirkt übertrieben und sollte nur von den tatsächlichen Inhalten ablenken. Der
Betrachter weiß, dass Helene unschuldig ist, aber Jugert überspielte damit die
Zeit ihrer Schwangerschaft, die sie im Gefängnis verbringt, so wie der
uneheliche Verkehr zwischen ihr und dem Verstorbenen zuvor nur angedeutet
wurde. Auch von Seiten der Bevölkerung sind kaum kritische Stimmen zu hören. Einmal
deutet Helene kurz an, dass sie wegziehen will, weil sie die unausgesprochenen
Vorwürfe spürt, aber näher konkretisiert der Film das nicht.
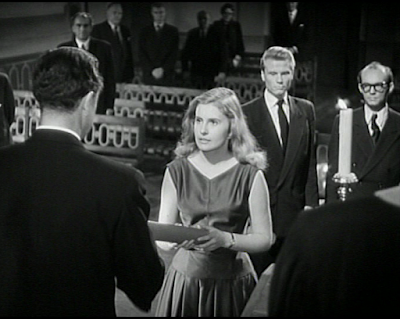
Die Absicht dahinter liegt auf der Hand. Regisseur und Autor
vermieden negativ besetzte Details, um die Identifikation mit der Hauptfigur
aufrecht zu erhalten. Kombiniert mit einer Vielzahl an unterhaltsamen Elementen
wurde der eigentliche Handlungsschwerpunkt relativiert, wodurch Helene Willfüers
für die damalige Zeit ungewöhnlich mutige Konsequenz fast einen nebensächlichen
Charakter erhielt. Das nahm „Studentin Helene Willfüer“ zu Unrecht die
Reputation, denn gerade die Vorsicht, mit der Rudolf Jugert seine Handlung
vorantrieb, vermittelt, wie gewagt es in den 50er Jahren noch war, eine selbstbewusst
und eigenständig agierende Frau in den Mittelpunkt eines Unterhaltungsfilms zu
stellen.
"Studentin Helene Willfüer" Deutschland 1956, Regie: Rudolf Jugert, Drehbuch: Frederick Kohner, Vicki Baum (Roman), Darsteller : Ruth Niehaus, Hans Söhnker, Elma Karlowa, Erik Schumann, Harald Juhnke, Otto Wernicke, Laufzeit : 97 Minuten
weitere im Blog besprochene Filme von Rudolf Jugert: