Inhalt: Gleißend brennt das Sonnenlicht auf einen mit einem
Maschinengewehr bewaffneten Mann, der alleine durch die wüstenähnliche Einöde
wankt und sich kaum auf den Beinen halten kann. Trotzdem trägt er den
metallenen Koffer weiter bei sich bis ihn die Hitze übermannt und er leblos an
einer staubigen Straße liegen bleibt. Als er mit seinem alten LKW vorbei fährt,
sieht ihn Charles Dump (Mario Adorf) und springt heraus, interessiert sich aber
nur für den Koffer. Das viele Geld darin lässt ihn einen großen Stein packen,
um den Mann endgültig zu töten, aber er kann sich nicht überwinden und lässt
ihn in der Hoffnung zurück, dass er dort von allein stirbt.
Dump, der seit Jahren in einem heruntergekommenen, von den
ehemaligen Arbeitern verlassenen Lager lebt, sieht in dem Geld eine Chance, endlich
von hier wegzukommen. Dass der Mann, dem er es gestohlen hat, noch lebt, hält
er plötzlich wieder für ein Risiko und dreht mit seinem LKW um. Doch inzwischen
hat sich Kid (Marquardt Bohm) erholt und zwingt ihn mit seiner
Maschinenpistole, ihn mitzunehmen. Nur ein kurzer Triumpf für ihn, denn im
Lager verlassen ihn erneut die Kräfte…
 |
| "Bübchen" (1968) |
Um die Wirkung von "Deadlock" auf den damaligen
Betrachter nachvollziehen zu können, ist es notwendig sich die Reaktion
anzusehen, die Roland Klicks zweiter Langfilm nach „Bübchen“ (1968) auslöste.
Nicht nur das er dafür kritisiert wurde, "zu stark auf Action gesetzt“ und
sich stilistisch am als zynisch und gewalttätig angesehenen Italo-Western
orientiert zu haben, die Konsequenz ging so weit, dass sein Film aus dem
Wettbewerb von Cannes ausgeladen wurde. Ihm erging es ähnlich wie etwa dem
Regie-Kollegen Rudolf Thome mit „Rote Sonne“ (1970), in dem Marquardt Bohm
ebenfalls die männliche Hauptrolle spielte – trotz einer modernen Bildsprache
und der Abkehr von gewohnten Erzähl-Strukturen, fanden sie als Autorenfilmer
des „neuen deutschen Kinos“ keine Anerkennung, da sie sich aus Sicht der
Kritiker zu sehr typischen Unterhaltungskriterien anbiederten.
 |
| "Deadlock" (1970) |
Der Irrsinn dieser Einschätzung steigert sich noch bei der
vergleichenden Hinzuziehung seines Erstlings „Bübchen“. Obwohl Roland Klick
darin mit skalpellartigen Schnitten die Mechanismen deutschen Kleinbürgertums
freilegte, ohne eine wertende Haltung einzunehmen, wurde auch „Bübchen“ keine
Anerkennung zuteil – zu nah geriet sein Film an die tatsächlichen deutschen Befindlichkeiten.
Auch wohlmeinende Kritiken sehen in „Deadlock“ einen thematischen Wandel zu „Bübchen“ – hier die stilisierte
Gangster-Story in einer wüstenähnlichen Landschaft, dort die Schilderung
deutschen Alltags in einer tristen Nachkriegs-Wohnsiedlung am Rande Hamburgs –
aber dieser Eindruck täuscht. Betrachtet man die zwei ersten stehenden
Einstellungen beider Filme, werden die Parallelen sichtbar. In „Bübchen“ fängt
die Kamera einen nicht weniger inhaltsleeren, neutralen Ort ein als in
„Deadlock“, wo Marquard Bohm vor Schwäche torkelnd durch eine von der Sonne
aufgeheizte felsige Einöde langsam auf die Kamera zuläuft. Die Gemeinsamkeiten
setzen sich fort in einer Story, die das unreflektiert selbstzerstörerische
Verhalten seiner Protagonisten nicht begründet, sondern in zwangsläufiger
Konsequenz abbildet.
Kid (Marquard Bohm) läuft schwer verletzt mit einem
metallenen Koffer durch die unendlich scheinende Sandwüste. Die Inszenierung
seines Zusammenbruchs verweist schon früh auf die enge Verzahnung der Filmmusik
von „Can“ zu der Hoffnungslosigkeit, die den gesamten Film prägt. Ihr Rhythmus
und die Schnitte zwischen der unbarmherzigen Sonne und dem erschlaffenden Körper
Kids (Marquard Bohm) werden zu einer sich steigernden Einheit bis es zu dessen
Zusammenbruch kommt. Zufällig findet ihn Charles Dump (Mario Adorf), der mit
seinem LKW auf dem Weg zu seinem Lager ist, leblos im Staub liegen. Nur wenig
interessiert an dem Mann, gilt sein Blick schnell dem Koffer, der sehr viel
Geld und eine Single enthält. Anstatt Kid zu helfen, will er ihn zuerst töten,
zögert, fährt davon, kehrt wieder zurück, um ihn doch zu beseitigen. Zu spät,
denn inzwischen konnte sich Kid wieder aufrappeln und zwingt Dump mit seinem
Maschinengewehr, ihn mit dem LKW mitzunehmen. Doch im Lager verlieren ihn
wieder die Kräfte und Dump hat erneut Oberwasser.
Diese ersten zwanzig Minuten, in denen Dump und Kid sich -
ständig verändernde Positionen einnehmend - begegnen, sind bis ins Detail in ihrer
psychologischen Tiefe beobachtet. Adorf spielte einen Lagerleiter, der seit
Jahren in einem verlassenen Camp haust, in dem nur noch eine gealterte
Prostituierte (Betty Segal) und deren Tochter (Mascha Elm-Rabben) vor sich hin
vegetieren. Alles wirkt provisorisch, unfertig und heruntergekommen. Dump sieht
das Geld als Chance, endlich von diesem Ort („Deadlock“ bedeutet sinngemäß
ausweglos) wegzukommen. Gleichzeitig ist er aber nicht mehr dazu in der Lage,
Entscheidungen zu treffen. Sein Verhalten wechselt zwischen übertriebener
Gewalttätigkeit und weinerlichem Selbstmitleid – der Grund dafür, warum Kid am
Leben bleibt. Mario Adorf lieferte ein weiteres Glanzstück als zerrissener
Charakter, während Marquard Bohm ähnlich wie in "Rote Sonne" wieder
ein Beispiel jugendlicher Coolness abgab, das auch heute noch jeden
Attraktivitätswettbewerb gewinnen würde, gerade weil es so typisch für diese
Zeit Anfang der 70er Jahre ist.
Klicks Film in die Nähe des Italo-Western zu rücken, bleibt
an der Oberfläche. Wie schon in „Bübchen“ nutzte der Regisseur Stilmittel
populärer Filme, um die inneren Befindlichkeiten seiner Protagonisten
zugespitzt herauszuarbeiten. „Deadlock“ wird zu einer Studie über Konsequenz,
innere Stärke und Selbsteinsicht, die jedem Autorenfilm des „neuen deutschen
Films“ zur Ehre gereicht hätte. Marquard Bohm entwickelte eine Gefühlskälte und
Fatalismus in seinem Charakter, die noch stärker hervortritt, als sein Partner
Anthony Sunshine (Anthony Dawson), ein gealterter Gangster, im Camp auftaucht. Klick
inszenierte ihn zwar im Stil eines Revolverhelden, doch seine äußerliche
Coolness erweist sich als Fassade, die langsam zu bröckeln beginnt. Während
Dump seine Unsicherheit mit übertriebenen und anbiedernden Gesten auszugleichen
versucht, nutzt Sunshine diese mit sadistischem Gestus für seine Zwecke aus, woran
erst dessen Schwäche und mangelndes Selbstbewusstsein gegenüber dem jüngeren
Kid deutlich wird. Ein Wechselspiel, das auf einen tödlichen, westernartigen
Showdown zuläuft.
 Entsprechend scheint das Etikett „Western“ nahe liegend, aber
Klick folgte in dem abschließenden Duell nicht den Regeln des Genres, sondern
blieb seiner eigenen Linie treu. Die von einer springenden Nadel erzeugten,
sich ständig wiederholenden zwei Töne, lassen in ihrer Penetranz nicht nur die
sengende Hitze fühlbar werden, sondern transportieren die nihilistische
Botschaft einer degenerierten und egoistischen Sozialisation. Im Italo-Western gehörte
der unmenschliche Zynismus zum guten Ton optischer Coolness, in „Deadlock“ bohrte
er sich ins Gedächtnis des Betrachters.
Entsprechend scheint das Etikett „Western“ nahe liegend, aber
Klick folgte in dem abschließenden Duell nicht den Regeln des Genres, sondern
blieb seiner eigenen Linie treu. Die von einer springenden Nadel erzeugten,
sich ständig wiederholenden zwei Töne, lassen in ihrer Penetranz nicht nur die
sengende Hitze fühlbar werden, sondern transportieren die nihilistische
Botschaft einer degenerierten und egoistischen Sozialisation. Im Italo-Western gehörte
der unmenschliche Zynismus zum guten Ton optischer Coolness, in „Deadlock“ bohrte
er sich ins Gedächtnis des Betrachters.
"Deadlock" Deutschland 1970, Regie: Roland Klick, Drehbuch: Roland Klick, Darsteller : Marquard Bohm, Mario Adorf, Anthony Dawson, Mascha Elm-Rabben, Betty Segal, Laufzeit : 88 Minuten

















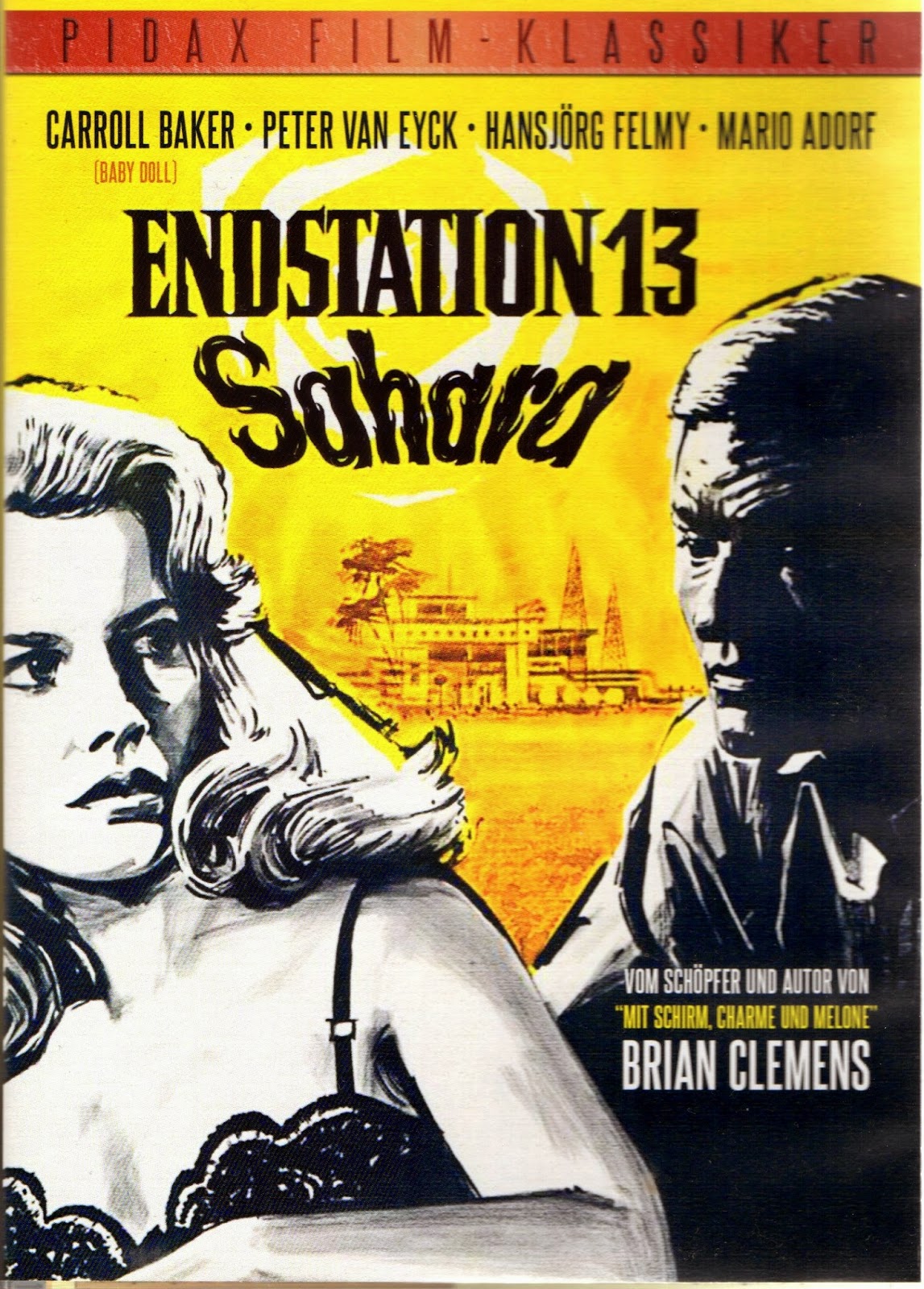












.jpg)


















