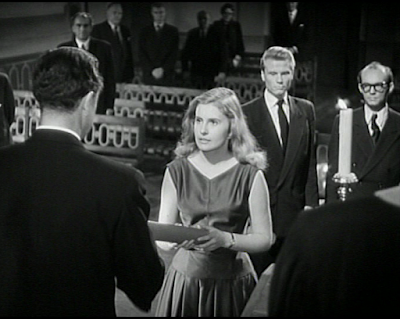Inhalt: Nachdem der Stadtschulrat sie kaum zu Wort kommen
ließ, sondern ihr vermittelt hatte, dass er ihr nach zweimaligem Verstoß gegen
die Vorschriften nur auf Grund des Lehrermangels eine weitere Chance gibt, führt
Frau Dr. Burkhardts (Ruth Leuwerik) Weg direkt zum Schiller-Gymnasium, wo
Direktor Cornelius (Hans Söhnker) über sie befinden soll. Dieser erweist sich
als so autoritär, wie humorvoll, und nimmt sie gerne als einzige Frau ins
Kollegium auf. Einzig hat er Bedenken, die Mathematik- und Physik-Lehrerin ausgerechnet
bei der Oberprima einsetzen zu müssen.
 Eine unbegründete Sorge, denn die junge Frau weiß sich
durchzusetzen, stellt aber im Gegenteil schnell fest, dass die Klasse in
Richtung Abitur-Prüfung hinter dem Lehrplan liegt. Zudem trifft sie in der nahe
gelegenen Pension von Frl. Richter (Agnes Windeck) zu ihrer Überraschung auf
einen der Schüler - Martin Wieland (Christian Wolff), dessen getrennt lebende
Eltern sich nur finanziell um ihren Sohn kümmern. Aus Frau Dr. Burghardts Sicht
ein unhaltbarer Zustand, der ihre Aufgabe zusätzlich erschwert.
Eine unbegründete Sorge, denn die junge Frau weiß sich
durchzusetzen, stellt aber im Gegenteil schnell fest, dass die Klasse in
Richtung Abitur-Prüfung hinter dem Lehrplan liegt. Zudem trifft sie in der nahe
gelegenen Pension von Frl. Richter (Agnes Windeck) zu ihrer Überraschung auf
einen der Schüler - Martin Wieland (Christian Wolff), dessen getrennt lebende
Eltern sich nur finanziell um ihren Sohn kümmern. Aus Frau Dr. Burghardts Sicht
ein unhaltbarer Zustand, der ihre Aufgabe zusätzlich erschwert. |
| Ruth Leuwerik 1924 - 2016 |
Schon in den 70er Jahren, als meine Kino-Sozialisation begann, gehörte Ruth Leuwerik zu den vergangenen Stars. Seit 1963 war sie kaum noch im Kino zu sehen, auch ihre TV-Präsenz blieb auf wenige Rollen beschränkt. Wiederholt wurden vor allem ihre Adels-Rollen in "Königliche Hoheit" (1953) und "Königin Louise" (1957), jeweils an der Seite von Dieter Borsche, mit dem sie damals ein "Traumpaar " bildete. Dass zwischen beiden Filmen vier Jahre lagen - im damaligen Filmgewerbe eine Ewigkeit - und diese Rollen eher untypisch für beide Darsteller waren, wurde ignoriert. Dieser Eindruck blieb auch an mir haften und den jetzigen Nachrufen zu ihrem Tod ist dieser Einfluss noch immer anzumerken.
Inzwischen wird die Modernität ihrer Frauenrollen und ihr selbstbestimmtes Auftreten zwar wieder betont, aber die dazu gehörigen Filme sind größtenteils in Vergessenheit geraten - auch weil sich die damalige Tragweite nicht mehr ermessen lässt. Themen, wie die Pädagogik-Diskussion in "Immer wenn der Tag beginnt" wirken inzwischen veraltet, auch lassen sich manche Konzessionen ans Publikum hinsichtlich der emanzipatorischen Ausrichtung nicht übersehen. Filme wie Käutners "Die Rote" (1962), die darauf verzichteten, sind bis heute aus der Öffentlichkeit verschwunden. Tatsächlich ist Ruth Leuweriks Schönheit und ihr Spiel auch gemessen an heutigen Klischees von Unabhängigkeit und Eigenständigkeit geprägt. Es gilt mehr denn je, sie wieder zu entdecken.
 Die knapp 30 Filme, die Ruth Leuwerik während ihrer Kino-Karriere
zwischen 1952 und 1963 drehte, besitzen eine bemerkenswerte Signifikanz -
ihre Beschränkung auf eine überschaubare Anzahl an Regisseuren, mit denen sie wiederholt zusammenarbeitete,
nahm einen fast symmetrischen Verlauf. Ihr Karrierebeginn stand unter dem Einfluss von Helmut Käutner und
dessen künstlerischem Umfeld. Nach Harald Braun ("Vater braucht
eine Frau" (1952) und "Königliche Hoheit" (1953)), häufiger
Produzent von Käutners Filmen, und dessen früheren Regie-Assistenten Rudolf
Jugert („Ein Herz spielt falsch“, 1953), besetzte Käutner selbst Ruth
Leuwerik in der Hauptrolle zwei seiner Filme („Bildnis einer Unbekannten“ (1954) und "Ludwig II: Glanz und Elend eines
Königs" (1955)). Auch gemeinsam mit Rolf Thiele entstand ein früher Film
("Geliebtes Leben" (1952)).
Die knapp 30 Filme, die Ruth Leuwerik während ihrer Kino-Karriere
zwischen 1952 und 1963 drehte, besitzen eine bemerkenswerte Signifikanz -
ihre Beschränkung auf eine überschaubare Anzahl an Regisseuren, mit denen sie wiederholt zusammenarbeitete,
nahm einen fast symmetrischen Verlauf. Ihr Karrierebeginn stand unter dem Einfluss von Helmut Käutner und
dessen künstlerischem Umfeld. Nach Harald Braun ("Vater braucht
eine Frau" (1952) und "Königliche Hoheit" (1953)), häufiger
Produzent von Käutners Filmen, und dessen früheren Regie-Assistenten Rudolf
Jugert („Ein Herz spielt falsch“, 1953), besetzte Käutner selbst Ruth
Leuwerik in der Hauptrolle zwei seiner Filme („Bildnis einer Unbekannten“ (1954) und "Ludwig II: Glanz und Elend eines
Königs" (1955)). Auch gemeinsam mit Rolf Thiele entstand ein früher Film
("Geliebtes Leben" (1952)). Sieht man von dem früh verstorbenen Harald Braun ab, ließ
sie ihre Filmkarriere mit denselben Regisseuren Anfang der 60er Jahre wieder
ausklingen. Thiele drehte mit ihr "Auf Engel schießt man nicht"
(1960), Jugert "Die Stunde, in der du glücklich bist" (1961) und
unter Käutner spielte sie noch dreimal, darunter in „Die Rote“ (1962)
und "Das Haus in Montevideo" (1963). Einzig Alfred Vohrer konnte sie
noch für zwei spätere Kinofilme gewinnen („Und Jimmy ging zum Regenbogen“ (1971)). In den fünf Jahren zwischen diesen beiden Phasen - im Zenit
ihrer Popularität - arbeitete sie fast ausschließlich an der Seite von Wolfgang Liebeneiner. Nach dem großen Erfolg von "Die Trapp-Familie" (1956) und
"Königin Louise" (1957) entstanden bis 1960 ("Eine Frau fürs
ganze Leben") sieben gemeinsame Filme.
Sieht man von dem früh verstorbenen Harald Braun ab, ließ
sie ihre Filmkarriere mit denselben Regisseuren Anfang der 60er Jahre wieder
ausklingen. Thiele drehte mit ihr "Auf Engel schießt man nicht"
(1960), Jugert "Die Stunde, in der du glücklich bist" (1961) und
unter Käutner spielte sie noch dreimal, darunter in „Die Rote“ (1962)
und "Das Haus in Montevideo" (1963). Einzig Alfred Vohrer konnte sie
noch für zwei spätere Kinofilme gewinnen („Und Jimmy ging zum Regenbogen“ (1971)). In den fünf Jahren zwischen diesen beiden Phasen - im Zenit
ihrer Popularität - arbeitete sie fast ausschließlich an der Seite von Wolfgang Liebeneiner. Nach dem großen Erfolg von "Die Trapp-Familie" (1956) und
"Königin Louise" (1957) entstanden bis 1960 ("Eine Frau fürs
ganze Leben") sieben gemeinsame Filme. "Immer wenn der Tag beginnt" markiert als vierter
Film dieser Reihe zwar die Mitte ihres Schaffens, blieb aber im Schatten ihrer
großen Filmerfolge, obwohl George Hurdalek erneut das Drehbuch verfasste.
Diesmal orientierte er sich weder an einer Biografie ("Die
Trapp-Familie"), noch wählte er einen historischen Stoff wie in
"Königin Louise", sondern entwarf ein Gegenwarts-Szenario. Hurdalek -
1942 am Propaganda-Film "Fronttheater" beteiligt - , der als Co-Autor
vieler Käutner- und Jugert-Filme zum Bindeglied zwischen Früh- und Hochphase in
Ruth Leuweriks Karriere wurde, betrat damit keineswegs Neuland. Im Jahr zuvor
hatte er für das Drogen-Drama "Ohne dich wird es Nacht" (1956) das
Drehbuch geschrieben, wenige Jahre später folgte die gesellschaftskritische
Satire „Rosen für den Staatsanwalt“ (1959).
"Immer wenn der Tag beginnt" markiert als vierter
Film dieser Reihe zwar die Mitte ihres Schaffens, blieb aber im Schatten ihrer
großen Filmerfolge, obwohl George Hurdalek erneut das Drehbuch verfasste.
Diesmal orientierte er sich weder an einer Biografie ("Die
Trapp-Familie"), noch wählte er einen historischen Stoff wie in
"Königin Louise", sondern entwarf ein Gegenwarts-Szenario. Hurdalek -
1942 am Propaganda-Film "Fronttheater" beteiligt - , der als Co-Autor
vieler Käutner- und Jugert-Filme zum Bindeglied zwischen Früh- und Hochphase in
Ruth Leuweriks Karriere wurde, betrat damit keineswegs Neuland. Im Jahr zuvor
hatte er für das Drogen-Drama "Ohne dich wird es Nacht" (1956) das
Drehbuch geschrieben, wenige Jahre später folgte die gesellschaftskritische
Satire „Rosen für den Staatsanwalt“ (1959). „Immer wenn der Tag beginnt“ nahm sich scheinbar die seit
1956 populären „Halbstarken“-Filme zum Vorbild, die mit ihrem moralischen
Gestus auf die sich verändernden soziokulturellen Veränderungen in der
Bundesrepublik reagierten. Der damals 19jährige Christian Wolff spielte 1957
nach „Anders als du und ich“ und „Die Frühreifen“ schon seine dritte Rolle als
schwer erziehbarer Jugendlicher, dessen Zukunft wegen des behaupteten
moralischen Niedergangs gefährdet ist. Diesmal gab er den Oberprimaner Martin
Wieland, ein verwöhntes Scheidungskind, das alleine in einer nahegelegenen
Pension wohnt und seine um die Welt jettenden Eltern nur selten zu sehen
bekommt. Die „Schule am Harthof“ in München, deren moderne, transparente
Architektur von der jungen Demokratie, wie vom allgemeinen Unternehmergeist
zeugte, bildete den stimmigen Hintergrund für das mit souveräner Autorität von Oberstudiendirektor
Wolfgang Cornelius (Hans Söhnker) geleitete Jungen-Gymnasium.
„Immer wenn der Tag beginnt“ nahm sich scheinbar die seit
1956 populären „Halbstarken“-Filme zum Vorbild, die mit ihrem moralischen
Gestus auf die sich verändernden soziokulturellen Veränderungen in der
Bundesrepublik reagierten. Der damals 19jährige Christian Wolff spielte 1957
nach „Anders als du und ich“ und „Die Frühreifen“ schon seine dritte Rolle als
schwer erziehbarer Jugendlicher, dessen Zukunft wegen des behaupteten
moralischen Niedergangs gefährdet ist. Diesmal gab er den Oberprimaner Martin
Wieland, ein verwöhntes Scheidungskind, das alleine in einer nahegelegenen
Pension wohnt und seine um die Welt jettenden Eltern nur selten zu sehen
bekommt. Die „Schule am Harthof“ in München, deren moderne, transparente
Architektur von der jungen Demokratie, wie vom allgemeinen Unternehmergeist
zeugte, bildete den stimmigen Hintergrund für das mit souveräner Autorität von Oberstudiendirektor
Wolfgang Cornelius (Hans Söhnker) geleitete Jungen-Gymnasium.„Wir haben die jungen Menschen geistig fit zu machen – für die Wissenschaft, für ihren Beruf“
 lautet sein Credo gegenüber der neuen Lehrerin Frau
Dr.Burkhardt (Ruth Leuwerik), die schon zweimal versetzt werden musste, weil
sie gegen Auflagen verstoßen hatte. Im Gegensatz zu ihren Vorgesetzten ist sie
der Meinung, dass der familiäre Hintergrund und damit die psychische Situation
eines Schülers bei der Beurteilung eines Vergehens mit berücksichtigt werden
sollte. Sie hatte einem Mädchen, das gestohlen hatte, nicht nur Geld geliehen,
sondern sie auch vor der Polizei geschützt, weil sie von ihren berufstätigen
Eltern vernachlässigt wurde. Cornelius argumentiert gegen diese Sichtweise mit
der schieren Anzahl an Schülern – bei 1600 Gymnasiasten sei es unmöglich, die
individuelle Situation des Einzelnen zu berücksichtigen. Einzig Disziplin sei
gefragt.
lautet sein Credo gegenüber der neuen Lehrerin Frau
Dr.Burkhardt (Ruth Leuwerik), die schon zweimal versetzt werden musste, weil
sie gegen Auflagen verstoßen hatte. Im Gegensatz zu ihren Vorgesetzten ist sie
der Meinung, dass der familiäre Hintergrund und damit die psychische Situation
eines Schülers bei der Beurteilung eines Vergehens mit berücksichtigt werden
sollte. Sie hatte einem Mädchen, das gestohlen hatte, nicht nur Geld geliehen,
sondern sie auch vor der Polizei geschützt, weil sie von ihren berufstätigen
Eltern vernachlässigt wurde. Cornelius argumentiert gegen diese Sichtweise mit
der schieren Anzahl an Schülern – bei 1600 Gymnasiasten sei es unmöglich, die
individuelle Situation des Einzelnen zu berücksichtigen. Einzig Disziplin sei
gefragt. Schon die Eingangssequenz, in der die Konfliktlinie zwischen
der damaligen Auffassung von konservativer und moderner Lehrmethodik gezogen
wurde, lässt deutlich werden, dass Hurdalek und Liebeneiner die Thematik nur
sanft ausloteten. Der Direktor wirkt trotz seiner autoritären Haltung
diskussionsbereit und die Mathematik- und Physik-Lehrerin legt höchsten Wert
auf gutes Benehmen. Einzig das Fehlverhalten von Eltern wird von ihr als
Ursache für die Probleme einzelner Schüler betrachtet – eine Mitte der 50er
Jahre aufkommende Meinung, als erste Tendenzen sich verändernder
Familienstrukturen, besonders hinsichtlich der Mutter-Rolle, spürbar wurden. Für
die peinlichste Situation des Films sorgt entsprechend Martin Wielands Mutter (Christl
Mardayn), die bei einem überraschenden Besuch ohne jegliches Feingefühl in eine
Jugend-Party platzt und ihren Sohn blamiert. Kein Wunder, dass er sich in seine
Lehrerin verliebt.
Schon die Eingangssequenz, in der die Konfliktlinie zwischen
der damaligen Auffassung von konservativer und moderner Lehrmethodik gezogen
wurde, lässt deutlich werden, dass Hurdalek und Liebeneiner die Thematik nur
sanft ausloteten. Der Direktor wirkt trotz seiner autoritären Haltung
diskussionsbereit und die Mathematik- und Physik-Lehrerin legt höchsten Wert
auf gutes Benehmen. Einzig das Fehlverhalten von Eltern wird von ihr als
Ursache für die Probleme einzelner Schüler betrachtet – eine Mitte der 50er
Jahre aufkommende Meinung, als erste Tendenzen sich verändernder
Familienstrukturen, besonders hinsichtlich der Mutter-Rolle, spürbar wurden. Für
die peinlichste Situation des Films sorgt entsprechend Martin Wielands Mutter (Christl
Mardayn), die bei einem überraschenden Besuch ohne jegliches Feingefühl in eine
Jugend-Party platzt und ihren Sohn blamiert. Kein Wunder, dass er sich in seine
Lehrerin verliebt. Abgesehen von dieser Szene, bleibt das auffälligste Merkmal
des Films seine Unauffälligkeit. Weder die Unterrichtsstunden mit der Oberprima
– seit der „Feuerzangenbowle“ (1944) klassischer Komödien-Stoff – noch deren
Jazz-Begeisterung wurden für zugespitzte Situationen genutzt. Konflikte
zwischen den Schülern gibt es nicht. Auf Sex oder Kriminalität, wie in den
„Halbstarken-Filmen“ üblich, wurde gänzlich verzichtet. Selbst der Tod eines
Schülers und das vom Hausmeister (Joseph Offenbach) entdeckte Tagebuch, in dem
Martin über seine Liebe zu seiner Lehrerin fantasiert, können kaum Dramatik
erzeugen. Innerhalb dieses unaufgeregten Szenarios wird schon die Entscheidung,
bei einer Beerdigung Jazz zu spielen, zum Wagnis. Dass ganz am Ende noch
Cornelius seine Studienrätin heiratet, kann nur als Konzession ans Publikum
verstanden werden. Angeblich hatten sie sich gleich zu Beginn ineinander
verliebt – zu spüren war es nicht.
Abgesehen von dieser Szene, bleibt das auffälligste Merkmal
des Films seine Unauffälligkeit. Weder die Unterrichtsstunden mit der Oberprima
– seit der „Feuerzangenbowle“ (1944) klassischer Komödien-Stoff – noch deren
Jazz-Begeisterung wurden für zugespitzte Situationen genutzt. Konflikte
zwischen den Schülern gibt es nicht. Auf Sex oder Kriminalität, wie in den
„Halbstarken-Filmen“ üblich, wurde gänzlich verzichtet. Selbst der Tod eines
Schülers und das vom Hausmeister (Joseph Offenbach) entdeckte Tagebuch, in dem
Martin über seine Liebe zu seiner Lehrerin fantasiert, können kaum Dramatik
erzeugen. Innerhalb dieses unaufgeregten Szenarios wird schon die Entscheidung,
bei einer Beerdigung Jazz zu spielen, zum Wagnis. Dass ganz am Ende noch
Cornelius seine Studienrätin heiratet, kann nur als Konzession ans Publikum
verstanden werden. Angeblich hatten sie sich gleich zu Beginn ineinander
verliebt – zu spüren war es nicht. Es ist diese untertemperierte Emotionalität, mit der „Immer wenn
der Tag beginnt“ besticht, der keinen Moment die im Zentrum stehende souveräne
Frauenrolle durch Gefühlswallungen diskreditierte. Sicherlich war das meist
respektvolle Auftreten sowohl des Lehrer-Kollegiums, als auch der Primaner
geschönt, so wie eine Frau innerhalb des männlich geprägten Umfelds im Film als
Ausnahme verstanden werden wollte, aber das lässt nicht übersehen, wie sehr
Ruth Leuwerik gegen damalige Klischees anspielte. Sie verband Schönheit,
Intelligenz, Humor und Selbstbewusstsein zu einer starken Persönlichkeit,
hinter der der sonstige Film nur eine Nebenrolle einnahm.
Es ist diese untertemperierte Emotionalität, mit der „Immer wenn
der Tag beginnt“ besticht, der keinen Moment die im Zentrum stehende souveräne
Frauenrolle durch Gefühlswallungen diskreditierte. Sicherlich war das meist
respektvolle Auftreten sowohl des Lehrer-Kollegiums, als auch der Primaner
geschönt, so wie eine Frau innerhalb des männlich geprägten Umfelds im Film als
Ausnahme verstanden werden wollte, aber das lässt nicht übersehen, wie sehr
Ruth Leuwerik gegen damalige Klischees anspielte. Sie verband Schönheit,
Intelligenz, Humor und Selbstbewusstsein zu einer starken Persönlichkeit,
hinter der der sonstige Film nur eine Nebenrolle einnahm."Immer wenn der Tag beginnt" Deutschland 1957, Regie: Wolfgang Liebeneiner, Drehbuch: George Hurdalek, Wolfgang Liebeneiner, Utz Utermann, Darsteller : Ruth Leuwerik, Hans Söhnker, Christian Wolff, Agnes Windeck, Friedrich Domin, Joseph Offenbach, Rex Gildo, Laufzeit : 96 Minuten
weitere im Blog besprochene Filme von Wolfgang Liebeneiner: